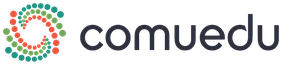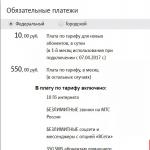Typische Diagramme chinesischer Telefonapparate. Diagramm zum Anschluss zweier Telefonapparate an eine Gegensprechanlage. Hauptkomponenten des Telefondiagramms
Ein einfaches Diagramm zum Verbinden zweier alter Telefonapparate, um eine bidirektionale Kommunikationsleitung zu organisieren. Es stellte sich heraus, dass nach dem Wohnungstausch zwei einfache Telefonapparate mit Wählscheibe überflüssig wurden. In der neuen Wohnung gab es keinen Telefonanschluss, und niemand bereute es – alle hatten Mobiltelefone.
Die Geräte blieben mehrere Jahre im Lagerraum, bis es notwendig wurde, eine bidirektionale Kommunikation zwischen der Garage und dem Landhaus (beide Objekte befinden sich auf demselben Gelände) zu organisieren.
Schematische Darstellung
Daher ist in Abbildung 1 das Diagramm eines typischen Telefonapparats dargestellt. B1 und M1 sind die Komponenten des Telefonhörers – ein Kohlemikrofon und eine elektromagnetische Kapsel. F1 - Anruf. S1, S2 – Wählgerät, bis es berührt wird. S1 ist geschlossen und S2 ist geöffnet.
Und wenn eine Nummer gewählt wird, schließt S2 und S1 öffnet den Stromkreis so oft, wie Einheiten für die gewählte Ziffer vorhanden sind. Wenn Sie beispielsweise „9“ drehen, wird die Leitung neunmal geöffnet. S3 ist ein Hebelschalter.
Reis. 1. Schematische Darstellung eines typischen Telefonapparats.
Wenn der Empfänger in der Position wie im Diagramm hängt, d. h. er verbindet eine Klingel mit der Leitung. Und wenn wir zum Telefonhörer greifen, ruft er nicht an, sondern legt den Hörer auf. Die Herausforderung besteht darin, diese beiden Schaltkreise miteinander zu verbinden.
Nach einer Suche im Internet habe ich mehrere Optionen gefunden, die jedoch alle über zusätzliche Anruftasten verfügen. Oder komplexe Schaltungen auf digitalen Mikroschaltungen – einzelne Mini-PBXs.
Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei einer Telefonleitung um eine Gleichstromquelle mit einer Spannung von etwa 60 V und einem Innenwiderstand von etwa 1000 Ohm.
Wenn ein Rufsignal eingeht, wird es zu einer Wechselspannungsquelle von etwa 100 V mit demselben Innenwiderstand. Das heißt im Prinzip, dass Sie zum „Sprechen“ Telefonapparate wie in Abbildung 2 anschließen müssen.

Reis. 2. Das einfachste Diagramm zum Verbinden zweier Telefonapparate.
Aber jetzt kommt die Herausforderung nach der anderen. Im Prinzip lässt sich das Problem auch mit einem solchen Schema lösen, insbesondere mit einigen einfachen Modellen von Telefonapparaten, die mit elektronischen Anrufen ausgestattet sind. Denken Sie daran, was passiert, wenn Sie den Hörer eines der parallelen Telefone abnehmen – die Klingel des zweiten Geräts klingelt oder quietscht.
Und wenn Sie mit dem Wählen einer Nummer beginnen, ertönt dieses Klingeln oder Piepen die ganze Zeit, in der die Nummer gewählt wird. Also, hier ist Ihr Rufsignal: Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie „0“. Das zweite Gerät klingelt zehnmal. Es gibt auch einen Nachteil: Erstens verhalten sich nicht alle Telefone so – es hängt vom Design des jeweiligen Klingelgeräts ab.
Zweitens ist der Ton selbst dann nicht so laut wie ein normaler Anruf. Es stellt sich heraus, dass Sie für einen vollständigen Anruf eine Wechselspannungsquelle benötigen.
Am einfachsten ist es, Wechselspannung über eine separate Leitung einzuspeisen. Dies stellt kein großes Problem dar, da es jetzt einfach ist, ein dreiadriges Kabel zu kaufen – es dient der elektrischen Verkabelung mit Erdung und ist in jedem Elektrofachgeschäft erhältlich. Darüber hinaus sind die Drähte mehrfarbig, was Verwechslungen beim Anschließen verhindert.
Das Ergebnis ist die in Abbildung 3 dargestellte Schaltung. Die Stromquelle ist ein vorgefertigter Transformator T1 mit einer Ausgangsspannung von 42 V. Die Spannung über den Gleichrichter an der Diode VD2 wird dem Kondensator C1 zugeführt.
Dabei wird eine konstante Spannung von ca. 60V erzeugt. Es wird über die Diode VD1 und den Widerstand R1 den Telefonapparaten TA1 und TA2 zugeführt.

Reis. 3. Schematische Darstellung der Verbindung von Telefonapparaten mit Anruffunktion.
Die Wechselspannung wird vor dem Gleichrichter entnommen und über die Schalttasten S1 und S2 den Telefonapparaten zugeführt. Drücken wir S1, wird TA2 mit Wechselspannung versorgt, dieser befindet sich im aufgelegten Zustand und klingelt daher.
Wenn wir S2 drücken, wird die Wechselspannung nun an TA2 geliefert, der aufgelegt ist und klingelt. Um also Teilnehmer TA2 anzurufen, drückt Teilnehmer TA1 die Taste S1, lässt sie los und wartet auf die Antwort. Um Teilnehmer TA1 anzurufen, macht Teilnehmer TA2 dasselbe, drückt jedoch die Taste S2.
Details und Design
Die Tasten S1 und S2 können in Telefongehäusen eingebaut werden – dort ist meist viel freier Platz. Der Transformator T1 ist fertig, Sie können jeden Transformator mit einer Sekundärspannung von 36 bis 50 V verwenden. Der Transformator kann sogar die niedrigste Leistung haben – der Laststrom in diesem Stromkreis beträgt nicht mehr als 50 mA.
Telefonapparate, die für den Betrieb in Telefonnetzen bestimmt sind, umfassen die folgenden obligatorischen Elemente: ein Mikrofon und ein Telefon, die in einem Hörer kombiniert sind, eine Klingeleinrichtung, einen Transformator, einen Trennkondensator, ein Wählgerät und einen Hebelschalter. Auf elektrischen Schaltplänen wird ein Telefonapparat mit dem Buchstaben E bezeichnet.
Schauen wir uns kurz den Zweck der Hauptelemente eines Telefons an.
Das Mikrofon wird verwendet, um die Schallschwingungen der Sprache in ein elektrisches Signal der Schallfrequenz umzuwandeln. Mikrofone können Kohlenstoff-, Kondensator-, elektrodynamische, elektromagnetische und piezoelektrische Mikrofone sein. Sie können in aktive und passive unterteilt werden. Aktive Mikrofone wandeln Schallenergie direkt in elektrische Energie um. Bei passiven Mikrofonen wird Schallenergie in eine Änderung einiger Parameter (meistens Kapazität und Widerstand) umgewandelt. Zum Betrieb eines solchen Mikrofons ist eine Hilfsstromquelle erforderlich.
In serienmäßig hergestellten Telefonapparaten werden in der Regel Kohlenstoffmikrofone verwendet, bei denen sich der elektrische Widerstand des unter der Membran befindlichen Kohlenstoffpulvers unter dem Einfluss von Schallwellen ändert. Die am weitesten verbreiteten Mikrofonkapseln sind die Typen MK-10, MK-16, die eine recht hohe Empfindlichkeit aufweisen (die beschriebenen Geräte verwenden hauptsächlich Kohlemikrofone). Auf Schaltplänen wird das Mikrofon mit den lateinischen Buchstaben VM bezeichnet.
Es ist zu beachten, dass seit kurzem auch eine Reihe von Telefonapparaten mit Kondensatormikrofonen der Typen MKE-3, KM-4, KM-7 ausgestattet sind.
Ein Telefon ist ein Gerät, das elektrische Signale in Ton umwandelt und unter Belastungsbedingungen für das menschliche Ohr funktioniert. Je nach Konstruktionsmerkmalen werden Telefone in elektromagnetische, elektrodynamische, mit differenziellem Magnetsystem und piezoelektrische Telefone unterteilt. Bei Telefonapparaten sind elektromagnetische Telefone am weitesten verbreitet. Bei solchen Telefonen sind die Spulen fest montiert. Unter dem Einfluss des in den Spulen fließenden Stroms entsteht ein magnetisches Wechselfeld, das eine bewegliche Membran antreibt, die Schallschwingungen aussendet. In modernen Telefonapparaten werden sie eingesetzt
hauptsächlich Telefonkapseln vom Typ TK-67 und in Geräten veralteter Bauart auch TK-47 und TA-4.
Das Betriebsfrequenzband für Mikrofone und Telefone, die in Telefonapparaten verwendet werden, liegt bei etwa 300 bis 3500 Hz. Auf Schaltplänen wird das Telefon mit den lateinischen Buchstaben BF bezeichnet.
Für eine einfache Bedienung sind Mikrofon und Telefon in einem Hörer vereint.
Das Klingelgerät wird verwendet, um das Wechselstrom-Klingelsignal in ein Audiosignal umzuwandeln. Zum Einsatz kommen elektromagnetische oder elektronische Klingelgeräte. Die erste davon ist eine Glocke mit einer oder zwei Spulen. Das Tonsignal entsteht durch den Schlag des Schlägers auf die Glockenteller. Der in den Spulen fließende Strom mit einer Frequenz von 16...50 Hz erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, das den Anker mit Schlagbolzen in Bewegung setzt. In der Regel werden bei Telefongesprächen Permanentmagnete verwendet, die eine bestimmte Polarität des Magnetkreises erzeugen, weshalb solche Telefonate als polarisiert bezeichnet werden. Der Widerstand der Glockenwicklungen gegenüber Gleichstrom beträgt 1,5...3 kOhm, die Betriebsspannung beträgt 30...50 V. Auf den Schaltplänen ist die Glocke mit den lateinischen Buchstaben HA gekennzeichnet.
Ein elektronisches Klingelgerät wandelt das Klingelsignal in einen Audioton um, der beispielsweise den Gesang eines Vogels imitieren kann. Als akustischer Sender wird ein Telefon oder ein piezoelektrisches Klingelgerät VP-1 verwendet. Solche Klingelgeräte werden beispielsweise in modernen Telefonapparaten TA-1131 „Lana“, TA-1165 „Stella“ usw. verwendet. Elektronische Klingelgeräte werden mit Transistoren hergestellt.
Der Telefonapparattransformator dient dazu, einzelne Elemente des Sprechteils zu verbinden und deren Widerstände an den Eingangswiderstand der Teilnehmerleitung anzupassen. Darüber hinaus können Sie den sogenannten lokalen Effekt beseitigen, auf den weiter unten eingegangen wird. Transformatoren werden mit getrennten Wicklungen oder in Form von Spartransformatoren hergestellt.
Der Trennkondensator dient als Element zum Anschluss des Rufgeräts an den Teilnehmeranschluss im Standby- und Rufempfangsmodus. Dies gewährleistet einen nahezu unendlich hohen Widerstand des Telefons bei Gleichstrom und einen niedrigen Widerstand bei Wechselstrom. In Telefonapparaten werden Trennkondensatoren der Typen MBM und K73-P mit einer Kapazität von 0,25...1 µF und einer Nennspannung von 160...250 V verwendet.
Der Dialer liefert Wählimpulse an den Teilnehmeranschluss, um die gewünschte Verbindung aufzubauen. Impulse werden verwendet, um die Leitung periodisch zu schließen und zu öffnen. Moderne Telefone verwenden mechanische und elektronische Wählgeräte. Ein mechanischer Drehwähler hat eine Scheibe mit zehn Löchern. Wenn die Scheibe im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird die Feder des Wählmechanismus aufgezogen. Nach dem Loslassen der Scheibe dreht sie sich unter der Wirkung einer Feder in die entgegengesetzte Richtung und die Kontakte, die die Teilnehmerleitung schalten, öffnen sich periodisch. Die erforderliche Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit der Rotation der Scheibe wird durch das Vorhandensein eines Fliehkraftreglers oder eines Reibungsmechanismus erreicht. Die Bildung von Impulsen bei freier Bewegung der Scheibe gewährleistet deren stabile Frequenz und den erforderlichen Abstand zwischen Impulspaketen, die zwei benachbarten Ziffern der gewählten Nummer entsprechen. Das erforderliche Intervall wird dadurch gewährleistet, dass die Anzahl der Öffnungen der Impulskontakte immer um ein oder zwei höher gewählt wird als die Anzahl der Impulse, die zur Einspeisung in die Leitung erforderlich sind. Dies gewährleistet eine garantierte Pause zwischen den Impulsstößen (0,2...0,8 s). In diesem Fall gelangen diese zusätzlichen Impulse nicht in die Leitung, da zu diesem Zeitpunkt die Impulskontakte von einer der Gruppen von Wählkontakten überbrückt werden. Es gibt auch Kontakte, die das Telefon beim Wählen einer Nummer schließen, um unangenehme Klicks zu vermeiden. Die Frequenz der vom Wählgerät erzeugten Impulse sollte (10 ± 1) Impulse/s betragen. Die Anzahl der Kabel, die das Wählgerät mit anderen Elementen des Telefons verbinden, kann 3 bis 5 betragen.
Elektronische Wählgeräte, die mit vielen modernen Telefonapparaten ausgestattet sind (z. B. TA-5, TA-7, TA-101), basieren auf integrierten Schaltkreisen und Transistoren. Die Nummer wird durch Drücken der Tasten der Tastatur – dem sogenannten Keypad – gewählt. Da die Tastendruckgeschwindigkeit beliebig hoch sein kann, werden beim Wählen einer Ziffer einer Rufnummer durchschnittlich 0,5 Sekunden eingespart. Darüber hinaus bieten Tastaturwählgeräte den Benutzern verschiedene zeitsparende Annehmlichkeiten:
Merken der zuletzt gewählten Nummer, die Möglichkeit, sich mehrere Dutzend Nummern zu merken usw. Elektronische Wählgeräte werden sowohl über die Teilnehmerleitung als auch über ein 220-V-Netz über ein Netzteil mit Strom versorgt.
Der Hebelschalter ermöglicht die Verbindung mit der Teilnehmerleitung eines Telefonklingelgeräts im Ruhezustand (der Hörer ist eingeschaltet) und mit Gesprächskreisen oder einem Wählgerät im Betriebszustand (der Hörer ist abgenommen). Ein Hebelschalter ist eine Gruppe mehrerer Schaltkontakte, die beim Abheben des Telefons aktiviert werden.
Zusätzlich zu den aufgeführten Elementen enthält das Telefongerät auch Widerstände, Kondensatoren, Dioden und Transistoren, die den Sprechkreis des Geräts bilden.
Betrachten wir das Gerät des Telefonapparats (TA) als Ganzes.
Wenn das Telefon im Gesprächsmodus betrieben wird, tritt ein lokaler Effekt auf, d. h. Hören Sie sich Ihre eigene Rede auf Ihrem Telefon an. Der lokale Effekt erklärt sich dadurch, dass der durch das Mikrofon fließende Strom nicht nur in den Teilnehmeranschluss, sondern auch in das eigene Telefon fließt. Um dieses unerwünschte Phänomen zu beseitigen, werden in modernen Telefonapparaten Anti-Lokal-Geräte eingesetzt.
Es gibt verschiedene Arten solcher Geräte. Betrachten wir eines davon – ein Anti-Lokal-Gerät vom Brückentyp (Abb. 1).
Mikrofon VM1, Telefon BF1, symmetrischer Schaltkreis Zb und Leitung Zl sind durch die Wicklungen des Transformators T1 miteinander verbunden: linear I, symmetrisch II und Telefon III. Wenn sich während eines Gesprächs der Widerstand des Mikrofons ändert, fließen Gesprächs-Audiofrequenzströme durch zwei Schaltkreise: linear und symmetrisch. Aus dem Diagramm geht hervor, dass die durch die Wicklungen I und II fließenden Ströme mit entgegengesetzten Vorzeichen summiert werden, sodass in Wicklung 111 kein Strom fließt, wenn die Ströme in der linearen und der ausgeglichenen Wicklung gleich groß sind. Dies wird durch entsprechende Auswahl der Elemente der Balanceschaltung Zb erreicht, deren Parameter von den Parametern der Leitung Zl abhängen. Der Leitungswiderstand enthält aktive und kapazitive Komponenten, sodass der symmetrische Schaltkreis aus Widerständen und Kondensatoren besteht.
Eine vollständige Eliminierung des lokalen Effekts wird nur bei einer bestimmten Frequenz und bestimmten Leitungsparametern erreicht, was unter realen Bedingungen unmöglich ist, da das Sprachsignal einen weiten Frequenzbereich enthält und die Leitungsparameter stark variieren (abhängig von der Entfernung des Teilnehmers). B. aus der Telefonzentrale, Übergangswiderständen und Kapazitäten in den Kabeln usw.), daher wird in der Praxis der lokale Effekt nicht vollständig zerstört, sondern nur abgeschwächt.
Betrachten wir das Diagramm des Telefonapparats TA-72M-5 (Abb. 2), der für den Betrieb in städtischen Netzen ausgelegt ist. Sein Schalt- und Rufteil besteht aus einem Hebelschalter SA1, einer Klingel HA1, einem Trennkondensator C1 und einem Wählgerät SA2. Der sprechende Teil des Telefons besteht aus Telefon BF1, Mikrofon VM 1, Transformator T 1, symmetrischer Schaltung (Kondensatoren C1 und C2, Widerstände R1-R3) und Begrenzungsdioden VD1, VD2. Der Sprechteil ist nach einem Gegenbrücken-Schema gefertigt.
Im Ausgangszustand der Kontakte des Hebelschalters SA1 und des Wählgeräts SA2, wie im Diagramm dargestellt, sind die in Reihe geschaltete Klingel HA1 und der Kondensator C1 mit der Leitung verbunden und der Sprechteil ausgeschaltet. Wenn an den Klemmen 1 und 4 des Telefonapparats Rufspannung auftritt, fließt Strom durch den Stromkreis: Klemme 1 – Brücke – Klemme 3 – Klingelwicklung – Öffnerkontakte SA1.2 des Hebelschalters – Kondensator C1 – Klemme 4. (Der (Die Richtung des Stroms wird bedingt gewählt – man könnte also auch davon ausgehen, dass er von Klemme 4 zu Klemme 1 fließt.) Nachdem der Teilnehmer den Anruf gehört hat, nimmt er den Hörer ab. In diesem Fall schalten die Kontakte SA1.1 und SA1.2 in eine andere Position, wodurch der Rufstromkreis ausgeschaltet und der Sprechstromkreis mit der Leitung verbunden wird. Der Gleichstromwiderstand zwischen den Anschlüssen 1 und 4 variiert von sehr hoch (Hunderte Kilo-Ohm – Mega-Ohm) bis relativ klein (Hunderte Ohm), dies wird von den Telefonzentralen aufgezeichnet und sie schalten in den Gesprächsmodus.
Beim Wählen einer Nummer befinden sich die Kontakte SA2.1 des Wählgeräts während der Vorwärts- und Rückwärtsdrehung der Scheibe in einem geschlossenen Zustand, was eine Umgehung des Gesprächskreises ermöglicht und die Möglichkeit des Abhörens von Klickgeräuschen am Telefon ausschließt. Beim Zurückdrehen des Wählgeräts unterbrechen die Kontakte SA2.2 den linearen Stromkreis und die Stationsgeräte erfassen anhand der Anzahl dieser Unterbrechungen die Rufnummer des angerufenen Teilnehmers.
Die Dioden VD1 und VD2 begrenzen Spannungsspitzen an den Telefonwicklungen und eliminieren scharfe Geräusche, die für das Ohr unangenehm sind.
Für den Betrieb in manuellen Telefonvermittlungsnetzen werden Telefonapparate ohne Wählgerät verwendet. Das Diagramm eines dieser Geräte (Typ TA-68CB-2) ist in Abb. dargestellt. 3. Der Hauptunterschied zum Vorgängergerät besteht im Fehlen von Wählkontakten und einer Gruppe von Hebelschalterkontakten, wodurch die Klingel und der Kondensator C1 im Gesprächsmodus mit der Leitung verbunden bleiben. Sie haben in diesem Modus jedoch praktisch keinen Einfluss auf den Betrieb des Telefons.
In den in diesem Buch beschriebenen Telefonkommunikationsgeräten können Sie industriell hergestellte Telefonapparate sowohl mit Wählgerät (TA-68, TA-72M-5, TA-1146 usw.) als auch ohne (TA-68CB-2 und andere) verwenden ähnlich). Telefone ohne Wählgerät sind jedoch nur für manuelle Telefonzentralen geeignet. Verfügt ein Funkamateur über ein Telefongerät, bei dem nur Hörer und Klingel funktionieren, kann auch dieses genutzt werden. In diesem Fall werden die Elemente gemäß dem in Abb. gezeigten Diagramm angeschlossen. 4. Kondensator C1 – Typ K73-17, MBM, MBGO. Es ist zu beachten, dass bei einem solchen Telefongerät der lokale Effekt voll zum Tragen kommt, der Einfachheit halber können Sie jedoch auf etwas Komfort verzichten.
Werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie Telefonleitungen in städtischen PBX-Anlagen geschaltet werden. Seit 1876, als der Schotte A.G. Bell das erste Zweidrahttelefon der Welt erfand, hat sich das Prinzip der Telefonkommunikation nicht wesentlich verändert.
Das Diagramm zur Organisation der Telefonkommunikation zwischen zwei Teilnehmern ist in Abb. dargestellt. 5. Stromversorgungsstrom für Telefonapparate El, E2 Pro-

geht über die Drosseln L1 und L2. Drosseln sind notwendig, um einen Kurzschluss des Wechselstroms durch die Gleichstromquelle Upit zu verhindern, deren Innenwiderstand sehr klein ist und Bruchteile eines Ohms beträgt. Die Gleichstromquelle wird üblicherweise Zentralbatterie (CB) genannt. Die Drosseln L1 und L2 haben einen relativ geringen Gleichstromwiderstand (normalerweise nicht mehr als 1 kOhm). Die Induktivität der Drosseln ist recht groß und erzeugt im Frequenzbereich der Wechselströme (300...3500 Hz) einen so großen Widerstand gegen den Wechselstrom, dass dieser praktisch nicht in die Zentrale verzweigt und einfließt der Stromkreis zwischen den Geräten E1 und E2. Bei automatischen Telefonzentralen werden die Wicklungen von Zweiwicklungsrelais üblicherweise als Drosseln verwendet, und diese Relais dienen gleichzeitig dazu, ein Signal über einen Anruf des Teilnehmers an der Station und ein Signal zum Beenden des Anrufs (Auflegen) zu empfangen.
Der Induktor erzeugt eine Wechselklingelspannung mit einer Frequenz von 16...50 Hz, die die Klingeleinrichtung des gewünschten Telefonapparates aktiviert.
Die Teilnehmervermittlung erfolgte zunächst manuell an der TK-Anlage, dann kamen auch Stepfinder zum Einsatz und heute erfolgt die Vermittlung quasi-elektronisch bzw. elektronisch. Impulsgesteuerte PBX-Schaltgeräte

Gleichstromsignale, die vom Telefonwählgerät erzeugt werden, wenn der Teilnehmer die Ziffern der Rufnummer des angerufenen Teilnehmers wählt.
Abbildung 6 zeigt das einfachste Prinzip des Verbindungsaufbaus an einer TK-Anlage. Der Telefonapparat des ersten Teilnehmers E1 ist über die Wicklungen des Zweiwicklungsrelais K1 mit der Zentralbank (Upit) verbunden. Wenn der erste Teilnehmer den Hörer des E1-Geräts abnimmt, wird das Relais K1 aktiviert und die Kontakte K 1.2 versorgen die Wicklung des Relais K2 mit Strom. Dieses Relais ist so konzipiert, dass der Anker nicht sofort nach Wegnahme der Spannung aus seiner Wicklung abfällt, sondern mit einer gewissen Verzögerung (in diesem Fall beträgt diese Verzögerung etwa 0,1 s). Die Relaiskontakte K2.2 bereiten den Stromkreis für den Stepper-Kurzschlussdetektor vor. Wenn der E1-Teilnehmer die Nummer des angerufenen Teilnehmers wählt, wird der Stromkreis der K1-Relaiswicklungen durch die Kontakte des E1-Telefonwählgeräts unterbrochen (dies geschieht, wenn sich das Wählgerät zurückbewegt). Die Kontakte K1.1 versorgen die Wicklung des Schritt-Kurzschlussmelders entsprechend der Nummer des angerufenen Teilnehmers mit Stromimpulsen. Nachdem die Rotation des E1-Telefonwählgeräts abgeschlossen ist, verbinden die Step-Finder-Kontakte die Leitung des Anrufers mit der Leitung des Angerufenen, woraufhin die Teilnehmer ein Gespräch führen können.
Wenn der Teilnehmer am Ende des Gesprächs den Hörer auf das Gerät E1 legt, fällt das Relais K1 ab, seine Kontakte K 1.2 öffnen den Stromversorgungskreis des Relais K2, das ebenfalls nach 0,1 s abfällt. In diesem Fall wird über die Kontakte K2.1, KZ.4 und KZ.3 die Wicklung des Schrittkurzschlussdetektors mit Strom versorgt. Der Kontakt KZ.4 gleitet entlang der massiven Lamelle des Stufenfinders und öffnet sich erst, wenn der Stufenfinder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Der Kontakt KZ.3 ist ein selbstunterbrechender Kontakt des Schrittfinders, der den Stromversorgungskreis der Wicklung des Schrittfinders unterbricht, wenn der Anker vom Kern angezogen wird.

Nick. Dank dieses Kontakts wird an der Kurzschlusswicklung eine Reihe von Impulsen erzeugt, die die Kurzschlusskontakte.1 und Kurzschluss.2 nacheinander in ihre ursprüngliche Position bringen.
Die Genauigkeit des Betriebs der Teilnehmerrelais und des Schrittfinders hängt von der Öffnungszeit der Wählkontakte ab, die 0,1 s nicht überschreiten sollte. Andernfalls kann das Relais K2 beim Öffnen der Kontakte K 1.2 den Anker nicht halten und die Verbindung erfolgt nicht. Daher müssen die Parameter von Telefonwählgeräten folgende Anforderungen erfüllen:
1) Impulsfrequenz des Wählgeräts 10 ± 1 Impuls/s;
2) Impulswiederholungsperiode 0,95...0,105 s;
3) eine Pause zwischen Impulsserien von mindestens 0,64 s;
4) das Verhältnis der Öffnungszeit zur Schließzeit des Impulskontakts des Wählgeräts, genannt Impulskoeffizient, abhängig von der Art der Telefonzentrale 1,3...1,9.
Die Zentralbatterie der Telefonzentrale versorgt die Teilnehmeranschlüsse mit einer konstanten Spannung Upit = 60 V. Bei abgenommenem Hörer des Telefonapparates wird die Telefonzentrale mit dem Innenwiderstand des Telefonapparates und damit der Spannung belastet an den Anschlussklemmen sinkt auf 10...20 V (abhängig von der Entfernung des Teilnehmers, abhängig von der Telefonzentrale und dem verwendeten Gerätetyp). Der Innenwiderstand eines Telefonapparats kann bei abgenommenem Hörer 200 bis 800 Ohm betragen, und der Betriebsstrom (Gesprächsstrom) durch das Gerät kann 20 bis 40 mA betragen. Der auf die Teilnehmersteckdosen reduzierte Widerstand der Telefonzentrale, der den Widerstand der Leitung, die Relaiswicklungen K1 (siehe Abb. 5) und den Innenwiderstand der Zentralbatterie umfasst, kann zwischen 600 Ohm und 2 kOhm liegen.
Bei einem Telefon mit Wählscheibe erfolgt die Wahl der Rufnummer eines Teilnehmers wie folgt: durch Drehen


Wählen Sie im Uhrzeigersinn bis zum Fingeranschlag, die Kontakte des Wählgeräts schließen die Leitung und bei Rückwärtsdrehung öffnet sich die Leitung so oft, wie es der gewählten Ziffer entspricht. In Abb. Abbildung 7 zeigt ein Zeitdiagramm des Betriebs des Telefons.
Als Rufsignal nutzt die TK-Anlage eine Wechselspannung von 80...120 V mit einer Frequenz von 16...30 Hz.
In den im Buch beschriebenen Telefonkommunikationsgeräten werden zwei Methoden zum Verbinden von Telefonleitungen verwendet: parallel und seriell (Abb. 8).
Die Schaltung mit Parallelschaltung von Telefonapparaten wurde oben besprochen (Abb. 5). Der Unterschied zwischen dem Diagramm in Abb. 8a besteht darin, dass anstelle von zwei Induktivitäten ein Stromstabilisator CT eingeschaltet ist, d.h. ein Netzwerk mit zwei Anschlüssen, dessen Strom unverändert bleibt, wenn sich die Parameter des externen Stromkreises innerhalb bestimmter Grenzen ändern.
In jedem Fall gilt die Beziehung L1 + L2 = L= const. Daher verursacht eine Stromänderung im Stromkreis des ersten Teilnehmers genau die gleiche Stromänderung im Stromkreis des zweiten Teilnehmers, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Dadurch ist eine höchstmögliche Gesprächslautstärke gewährleistet. In der Praxis kann man in Gegensprechanlagen anstelle eines Stromstabilisators auch einen Widerstand mit einem Widerstand von 1...5 kOhm verwenden, allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Gesprächslautstärke etwas abnimmt.
In Abb. In Abb. 8.6 zeigt ein Diagramm der seriellen Verbindung von Telefonapparaten. Bei dieser Verbindung fließt der Gesprächsstrom eines Gerätes vollständig durch das zweite Gerät, was die maximal mögliche Gesprächslautstärke (unter gegebenen Bedingungen) gewährleistet.
Es ist zu beachten, dass in städtischen PBX-Anlagen aufgrund der Komplexität der Vermittlungsgeräte die serielle Methode zum Anschluss von Telefonleitungen nicht verwendet wird. (In dem Buch wird diese Methode in Gegensprechanlagen und manuellen Telefonzentralen verwendet.)
ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE AUSLÄNDISCHER TE
Das Diagramm in Abb. 4.7 wird in Mobiltelefonen verwendet und ist in Tischtelefonen praktisch nicht zu finden. Der einzige Vorteil dieses Schemas ist seine Einfachheit. Alles andere sind leider Mängel. Die Transistoren VT2, VT3 mit den Widerständen R9, R10, R11 stellen einen Impulsschaltkreis dar, dessen Funktionsweise in Abschnitt 3.4 besprochen wurde (Abb. 3.34). Der Transistor VT2 in dieser Schaltung gleicht zusätzlich das Ausgangssignal des Mikrofons mit dem Eingang des Transistors VT4 ab, der das Mikrofonsignal mit Strom verstärkt. Der Transistor VT3 arbeitet im Schaltmodus und führt keine anderen Funktionen aus.
Aufgrund des Fehlens eines Verstärkers für das von der Leitung empfangene Signal ist die Hörbarkeit in Telefonen, die ein solches Schema verwenden, recht gering. Dieser Nachteil kann durch die Verwendung eines dynamischen Kopfes behoben werden, allerdings wird in diesem Fall das Mikrofonsignal schwächer. Dieser Schaltungstyp kann nur mit ENN-ICs verwendet werden, deren IR-Ausgang ein Open-Drain ist. Es unterscheidet sich von anderen Schemata durch die erhöhte Netzspannung im Gesprächsmodus (10 - 15 V).
Die Versorgungsspannung (ca. 3 V) des Elektretmikrofons wird vom Widerstand R14 abgenommen. Der Kondensator C5 im Stromkreis des dynamischen Kopfes BF1 ist ein Trennkondensator.
In Abb. Abbildung 4.8 zeigt ein Diagramm, das am häufigsten bei Tischtelefonen und Mobiltelefonen aus südostasiatischen Ländern zu finden ist. Die Schaltung wird mit verschiedenen Dialer-Chips (KS5805A, KS5851, UM9151-3 usw.) verwendet. Die Funktionseinheiten dieser Schaltung werden in den entsprechenden Kapiteln ausführlich besprochen.
In Abb. Abbildung 4.9 zeigt ein Diagramm eines Telefons mit zusätzlichem Speicher für 10 Nummern. Die Vorgehensweise zum Arbeiten mit zusätzlichem Speicher ist im Abschnitt 2.8 beschrieben. Die Funktionsweise von IR ist in Abschnitt 3.4 beschrieben (Abb. 3.34). Die Konversationseinheit ist nach dem in Abb. gezeigten Diagrammtyp aufgebaut. 3.36 Abschnitt 3.5. Sehr oft verwendet dieses Schema auch den in Abb. gezeigten Konversationsknoten. 3.38.
In Abb. In Abb. 4.10 zeigt ein Diagramm des in Bulgarien hergestellten BELOGRADCHIK-Telefons mit zusätzlichem Speicher für 10 Nummern. Die Schaltung weist gute Eigenschaften eines Konversationsknotens auf. Die Zenerdiode VD5 dient als Schutz. Diode VD9
Im Konversationsmodus blockiert es die Impulstaste, da in diesem Modus der NSI-Ausgang (Pin 9) des DD1-ICs Spannung hat "hoch" Ebene.
Beim Wählen wird der Gesprächsknoten durch die Transistoren der Gesprächstaste VT1, VT2 ausgeschaltet. Die Kathode der Diode VD9 ist vom Neutralleiter getrennt, wodurch ein Impulsschalter an den Transistoren VT3, VT4 betätigt werden kann.
Der IC wird von den Dioden VD6 - VD8, VD11 gespeist.
In Abb. Abbildung 4.11 zeigt ein Diagramm eines TA mit dem „HOLD“-Modus.
Dieser Modus funktioniert wie folgt. Im Gesprächsmodus sind die Transistoren VT1, VT2 gesperrt, wenn der Hörer abgenommen ist. Wenn Sie die Taste „HOLD“ drücken, öffnet sich der Transistor VT1, wodurch der Transistor VT2 geöffnet wird. Strom fließt durch den offenen Transistor VT2, den Widerstand R8, R12 und die Diode VD10 und öffnet den Transistor VT3. Der Transistor VT3 umgeht das Mikrofon VM1. Gleichzeitig erhöht sich der Strom durch die VD16-LED, wodurch sich deren Helligkeit erhöht.
Wenn Sie nun den Hörer auf das Gerät legen, kehrt der Schalter SB1 in den in der Abbildung gezeigten ursprünglichen Zustand zurück. In diesem Fall wird die Verbindung zur Leitung über den Stromkreis aufrechterhalten: offener Transistor VT2, Widerstand R8, Diode VD11, LED VD16. In diesem Modus können Sie zu einem Paralleltelefon wechseln und das Gespräch fortsetzen.
Wenn Sie den Hörer eines parallelen Telefons abnehmen, wird dieses mit der Leitung verbunden und senkt als zusätzlicher Widerstand die Leitungsspannung. Da sich die Spannung am Kondensator C2 in diesem Moment nicht geändert hat, schließt das größere Potenzial an der Basis des Transistors VT2 diesen und das erste Telefon wird von der Leitung getrennt.
In Abb. Abbildung 4.12 zeigt ein Diagramm eines TA mit Frequenzwahl. Vom Aufbau her ist die Schaltung der in Abb. gezeigten Schaltung sehr ähnlich. 4.8 und unterscheidet sich davon nur dadurch, dass der Betrieb der automatischen Telefonzentrale durch einen Mehrfrequenzcode 2 aus 8 und nicht durch das Senden von Gleichspannung gesteuert wird.
In Abb. Abbildung 4.13 zeigt ein Diagramm eines TA, der auf der Basis der Mikroschaltung UM9151 erstellt wurde. Die Vorspannung am Ausgang des Open-Drain-Impulsschalters (Pin 9) wird vom logischen Ausgang der IC-Talk-Taste (Pin 13) über den Widerstand R16 geliefert. Durch die Einbeziehung von IR wird der direkte Einfluss der Netzspannung auf den Ausgang des IR-IC eliminiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls des Dialer-Chips verringert wird.
In Abb. Abbildung 4.14 zeigt ein Diagramm des Telefonapparats „GALAX“, Modell UP-722TP. Der TA-Körper besteht aus transparentem Kunststoff. Wenn ein Induktor-Rufsignal eintrifft, übernehmen die mehrfarbigen Neonlampen LP1 - LP5 die Funktion einer Ruflichtanzeige. Im Gesprächsmodus und beim Wählen beleuchten die LEDs LED1 und LED2 die Telefontastatur.
Im TA, dessen Diagramm in Abb. 4.15 ist es möglich, sowohl im Puls- (PULSE) als auch im Frequenzmodus (TONE) zu arbeiten. Das Verfahren zur Programmierung des NM9112A IC wird in Abschnitt 2.9 erläutert. Der TA-Gesprächsknoten besteht aus zwei unabhängigen Knoten, von denen einer die Bedienung mit dem Mobilteil ermöglicht, der andere den „HANDSFREE“-Modus, d.h. Sie arbeiten mit einem Mikrofon und einem dynamischen Kopf, die in das TA-Gehäuse integriert sind, sodass Sie telefonieren können, ohne den Hörer abzunehmen, und die Hände frei haben.
In der linken Position des Schalters SW1.2 ist laut Abbildung das Mobilteil angeschlossen, in der rechten Position ist der „HANDSFREE“-Modus implementiert.
In Abb. In Abb. 4.16 zeigt einen typischen elektrischen Schaltplan der TA-Marke Tel 01 und FeTAr von SIEMENS. Der Hauptunterschied der Schaltung besteht darin, dass der Impulsschalter auf einem p-Kanal-Hochspannungs-Feldeffekttransistor BSS92 basiert (das inländische Analogon ist KP402A, hergestellt von JSC SVETLANA in St. Petersburg). Der Konversationsknoten-IC PSB4500 unterscheidet sich funktionell nicht vom IC TEA1068, der ausführlich in Kapitel 3 besprochen wird. Der IC PSB8510-1 ist ein Tonimpuls-Wählgerät, dessen Betrieb über die Pins 9 und 20 (durch Anschluss an die Stromversorgung) programmiert wird Versorgungsplus, der gemeinsame Pin oder unverbunden bleiben). Anschluss von P1 und P2 gemäß dem Diagramm in Abb. 4.16, der Impulsmodus des IC ist standardmäßig eingestellt, der Impulskoeffizient beträgt 1,5 und eine programmierbare Pause beim Wählen einer Nummer beträgt 3 s. Die Telefon-Mikroschaltungen von SIEMENS werden in der nächsten Ausgabe ausführlich besprochen.
Funktionsweise der in Abb. dargestellten Schaltungsknoten. 4.17 - 4.19, wird in den entsprechenden Abschnitten ausführlich beschrieben.
Für den Betrieb des Telefons müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die Stromversorgung der Gesprächskreise mit einer konstanten Spannung von 1,5 - 9 Volt (je nach Gerätetyp) und die Versorgung der Gesprächskreise mit einer Wechselspannung von 40 V - 60 Volt, 25 - 50 Hz. Basierend auf dem Stromversorgungsprinzip werden Telefonapparate in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe umfasst lokale Batteriegeräte (MB), bei denen sich alle Stromquellen im Inneren befinden: eine galvanische Batterie zur Stromversorgung der Gesprächskreise und eine manuelle Wechselstrominduktivität zum Senden eines Anrufs an den Teilnehmer. Zu diesen Telefonen gehören die militärischen Feldgeräte TAI-43 und TA-57. Die zweite Gruppe umfasst Geräte mit Zentralbatterie (CB), deren Stromkreise von einer Zentrale oder einer automatischen Telefonzentrale mit Strom versorgt werden; diese Geräte verfügen nicht über eigene Stromquellen. Zu diesen Telefonen zählen alle Geräte mit Wählgeräten und einige andere Typen für den allgemeinen Gebrauch: TA-68, TAN-70, VEF TA-12, Aster usw. Wenn die Geräte der ersten Gruppe über eine Zweidrahtleitung miteinander verbunden sind, Da es sich um MB-Geräte mit lokaler Batterie handelt, beginnen sie sofort und ohne Probleme zu arbeiten. Damit zwei miteinander verbundene Geräte der Zentralbank der zweiten Gruppe funktionieren, habe ich ein spezielles Gerät zusammengebaut. Es gibt eine ganze Reihe von Beschreibungen solcher Geräte, aber alle diese Schemata haben, wie bereits geschrieben, einen erheblichen Nachteil: Zum Anschluss der Geräte ist eine dreiadrige Leitung erforderlich. Das von mir zusammengebaute Gerät ermöglicht den Betrieb über eine Zweidrahtleitung.Die Stromversorgung selbst befindet sich auf der Seite eines der Teilnehmer und besteht aus einem Abwärtstransformator Tr1. Die Sekundärwicklung des Transformators liefert zwei Spannungen: 40 und 15 Volt. Eine Wechselspannung von 40 Volt versorgt die Rufstromkreise. Die zweite Spannung wird von der CC-Brücke gleichgerichtet und durch einen Stabilisator am ROLL stabilisiert – sie wird zur Stromversorgung der Gesprächskreise verwendet. Der Stabilisator und der Kondensator C1 werden benötigt, um die Hintergrundwechselspannung während eines Gesprächs zu reduzieren. Der Stabilisator kann vernachlässigt werden, wenn der Hintergrund nicht groß ist. KN-Tasten werden ohne Befestigung verwendet und in Telefongehäusen montiert. Die Verbindung des TA2-Geräts mit dem TA1-Gerät und dem Telefongerät erfolgt über ein zweiadriges TRP 1 x 2-Kabel. Die unteren Kontakte der Schalter KN1 und KN2 gemäß Diagramm sind geerdet. Die Erdung kann ein Wasserversorgungsrohr, ein Heizungsrohr oder ein in den Boden getriebener Metallstift sein. Ich habe den Massekontakt einer Eurosteckdose genutzt.

Funktionsweise der Schaltung. Wenn Sie die KN1-Taste am TA1-Gerät drücken, wird eine Wechselspannung von 40 V von der Transformatorwicklung über die geschlossenen Kontakte der EH1-Taste über die Leitung, die normalerweise geschlossenen Kontakte von KN2, an das Klingelgerät des TA2-Geräts geliefert. (Wenn das Mobilteil auf dem Gerät liegt, ist ein klingelndes Gerät mit der Leitung verbunden). Vom Gerät über die Leitung, Kondensator C1, zur zweiten Pferdewicklung 40 V. Das Telefon TA2 klingelt. Durch Abheben der Telefonhörer in beiden Geräten und Drücken der Tasten KH1 und KH2 werden die Gegensprechkreise der Geräte mit der Leitung verbunden. In diesem Fall wird die 12-Volt-Gleichstromversorgung in Reihe mit den Telefonapparaten geschaltet. Nach Stromkreis: Kondensator C1 plus Stromversorgung, Verbindungsleitung, gesprochene Stromkreise des TA2-Geräts, geschlossene Kontakte der KN2-Taste, Leitung, geschlossene Kontakte von KN1, gesprochener Stromkreis des TA1-Geräts, minus Stromversorgung. Das Schema funktioniert ähnlich, wenn ein Anruf vom TA2-Telefongerät gesendet wird. Wenn die Taste KN2 gedrückt wird, gelangt eine 40-V-Klingelwechselspannung von der Transformatorwicklung über die Erdungs- und geschlossenen Rufkontakte von KN2 in die Leitung und über die Kontakte von KN1 zum Telefonklingel TA1 und zum zweiten Ende der 40-V-Wicklung Tr1. Das Gespräch der Teilnehmer erfolgt nach der oben beschriebenen Schaltung. In meinem Fall der Verwendung dieses Geräts gab es am Installationspunkt des TA2-Telefons überhaupt keine Leitungen außer der Erdung und einem Kabelfernsehkabel zum Fernseher. Die Verlegung einer neuen Leitung durch das Gebäude war weit weg und teuer, und das Fernsehkabel verlief nicht weit von der Installation des TA1-Telefons entfernt. Dadurch konnte ich die Telefonapparate TA1 und TA2 über das bereits installierte Fernsehkabel RK75 anschließen, ohne den Betrieb des Fernsehers zu stören. Zu diesem Zweck habe ich spezielle Isolationsfilter am Kabel installiert.

Die Drosseln Dr1 und Dr2 dienen dazu, hochfrequente Fernsehsignale von eindringenden Telefonen zu unterdrücken und gleichzeitig den physikalischen Stromkreis zwischen den Geräten aufrechtzuerhalten. Auf MLT 100-Widerstände mit PEL 0,2-Draht gewickelt, bis er gefüllt ist. Als zweite Ader der Leitung wird das Schirmgeflecht des RK75-Kabels verwendet. Die Kondensatoren C1 und C2 verhindern, dass Spannung in Elemente von Fernsehgeräten eindringt, übertragen aber wiederum hochfrequente Fernsehsignale gut. Alles funktioniert stabil.
Obwohl Mobiltelefone fest und dauerhaft in unser Leben integriert sind, nutzen viele Menschen normale Festnetztelefone. Sie sind immer an Ort und Stelle und sicher für die Gesundheit. Ihre Fehlfunktionen sind viel seltener als bei Mobiltelefonen und hängen hauptsächlich mit einer Verletzung des Kontakts der verdrillten Drähte von Hörer, Mikrofon und Telefonkapsel zusammen. Es kommt häufig vor, dass das Gerät auf den Boden fällt.
Ich griff mit dem Schlauch in der Hand nach dem Griff, das Gerät war leicht, es rutschte vom Tisch und direkt auf den Boden ... Knall, oder vielleicht haben sie geistesgestört versucht, den Hörer aufzulegen oder wollten selbst daran festhalten 🙂 ... die Geschichte schweigt. Wie in solchen Fällen üblich, zerreißt der Besitzer sein Hemd und behauptet, das Telefon funktioniere, ruft dann aber plötzlich nicht mehr an. Die Einzelheiten aus dem Leben des Besitzers interessieren uns wenig, und wenn er nicht über die Ursache der Panne sprechen möchte, dann ist das seine persönliche Angelegenheit.
Die Störung ist nicht kompliziert, Sie müssen das Gerät nicht zur Reparatur bringen – jeder kann es beheben!
Nach einer Sichtprüfung des Telefonapparats TX-210M lag die Schlussfolgerung nahe. Das Gerät hing an der Wand und stürzte heftig ab.
Alles ist klar. Der Telefonhalter auf der Rückseite wurde von den Wurzeln herausgerissen.

Wir öffnen das Gerät. Und hier ist alles klar.

Das Piezoelement der Glocke wurde aus seinem Platz gerissen und der Draht löste sich.

Es braucht nicht viel Intelligenz, um zu verstehen, wo der Bruch aufgetreten ist. Wir erhitzen den Lötkolben und kleben den Draht an die Stelle, an der er sein soll.

Wir schließen unseren Telefonapparat an die Telefonsteckdose an. Wir wählen die Nummer unserer Liebsten (oder Freundin) und bitten sie, Sie dringend anzurufen. Wir prüfen den Anruf. Alles funktioniert super!
Wir setzen das piezoelektrische Element ein, wir kleben es nicht mit Moment-Kleber, wir machen es zuverlässiger, wir kleben es auf Schmelzkleber.


Reparatur von Handyhüllen
Jetzt müssen wir nur noch das Loch in unserem Gerät reparieren. Wir reißen eine Plastikplatte von einem anderen defekten Telefon oder etwas anderem ab, ich habe sie von einem alten Fernseher abgerissen :)

Wir bohren zwei Löcher – eines größer, das andere kleiner. Wir verbinden diese Löcher und erhalten diese Schönheit. Wenn Sie eines haben, können Sie natürlich auch ein fertiges Ohr aus etwas schneiden.

Schneiden Sie mit einem normalen Messer die Risswunde des Lochs ab.

Jetzt lasst uns dieses riesige Loch mit unserer Schönheit füllen.

In etwa so können Sie einen Bolzen oder eine Schraube verwenden, wie Sie möchten und möchten.


Und der letzte Schliff besteht darin, Heißkleber außen um den Umfang der Platte aufzutragen und den Kleber hineinzugießen, ohne ihn zu verschonen, damit er fest an Ort und Stelle bleibt.

Am Beispiel dieses Telefons haben wir gesehen, dass Sie die Störung problemlos selbst beheben können. Beim Öffnen des Telefons können weitere ähnliche Fehler auftreten. Beispielsweise kann das Bein eines Transformators, eines Kondensators oder eines anderen schweren Teils abbrechen. Untersuchen Sie sorgfältig das Innere des Telefons: die Leiter und die Rückseite der Leiterplatte.
Blockschaltbild eines Tastentelefons

Mehrere Schemata von Tastentelefonen





Viel Glück bei der Renovierung!
(Wir haben Materialien von der Seite „auf dem Knie“ verwendet)
P O P U L A R N O E:
Antivirus TrustGo & Mobile Security
Heutzutage ist das globale Internet voller Viren aller Art und verschiedener Spyware. Wenn Sie das Internet nutzen, ist es aus Gründen der Sicherheit Ihres Telefons besser, ein Antivirenprogramm zu installieren.